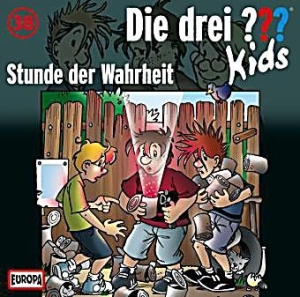Wenn man eine solche Behauptung aufstellt, gilt es sich zu fragen, wer von einer solchen Steuer überhaupt betroffen ist und wie diese tatsächlich dann auf die Volkswirtschaft wirkt. Wenn wir uns zunächst den Initiativtext zu Gemüte führen, erfahren wir, welche Personen und Organisationen von dieser Steuer tatsächlich betroffen sein werden. So sind von der Erbschaftssteuer nur natürliche Personen betroffen, keine Unternehmen und keine Landwirtschaftsbetriebe. Besteuert werden nur Nettovermögen, d. h. Schulden wie etwa Hypotheken werden abgezogen.
Es gilt ein Freibetrag von zwei Millionen Franken auf der Summe des Nachlasses und aller steuerpflichtigen Schenkungen pro Erblasser, umso mehr als der Freibetrag bei einem Paar bei jedem Erbgang gewährt wird und so unter dem Strich vier Millionen steuerfrei weitergegeben werden können. Steuerbefreit bleiben weiterhin jene Teile des Nachlasses und die Schenkungen, die dem Ehegatten, der Ehegattin, dem registrierten Partner oder der registrierten Partnerin zugewendet werden. Und gehören Unternehmen oder Landwirtschaftsbetriebe zum Nachlass oder zur Schenkung und werden sie von den Erben, Erbinnen oder Beschenkten mindestens zehn Jahre weitergeführt, so gelten für die Besteuerung besondere Ermässigungen, damit ihr Weiterbestand nicht gefährdet wird und die Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Ergänzend kommt noch hinzu, dass die Erbschaftssteuer nicht auf den Nachlass einer Person erhoben wird, die im Zeitpunkt des Todes ihren Wohnsitz im Ausland hatte oder bei denen der Erbgang im Ausland eröffnet worden ist.
Aus diesem bunten Strauss von Ausnahmen können wir davon ausgehen, dass der aller grösste Teil der schweizerischen Bevölkerung keine Erbschaftssteuer bezahlen wird. Als weiterer zu beachtender Faktor, wer von der Erbschaftssteuer betroffen sein wird oder nicht, ist die Vermögenskonzentration. Diese Grösse sagt aus, welcher Teil der Bevölkerung in der Schweiz wie viel des gesamten Volksvermögen besitzt. Es ist eine Binsenwahrheit, dass diese Konzentration in der Schweiz extrem hoch ist, was verschieden Studien beweisen. So kommt der schweizerischen Nationalfond in einem breit angelegten Forschungsprojekt zum Schluss, dass im Jahr 2000 die durchschnittlich vererbte Summe pro Erblasserin oder Erblasser bei 456000 Franken lag, wobei zehn Prozent der Erbenden 75 Prozent der schweizweit vererbten Summe von 28,5 Milliarden Franken erhielten.
Dies führt ebenfalls zum Schluss, dass die Erbschaftssteuer nur wenige treffen wird, jene also, die tatsächlich einen grossen Nachlass einstreichen werden. Basierend auf obigen Tatsachen wird die angepasste Erbschaftssteuer keine zwei Prozent der Bevölkerung treffen. Diese Zahl wird auch dadurch unterstützt, dass im 2010 gerade mal 1,87 Prozent aller Steuerpflichtigen ein Reinvermögen von über zwei Millionen Franken versteuerten (Bundesamt für Statistik). Der Mythos, dass die Erbschaftssteuer die Wirtschaft schwächt und Arbeitsplätze gefährdet ist bleibt eine Mär, die von den Wirtschafts- und Gewerbeverbänden wie auch von der bürgerlichen Parteien ohne irgendwelche Grundlagen weiterhin kolportiert wird.
Das Gegenteil ist der Fall: Eine Umverteilung der Vermögen von oben nach unten wie z. B. durch Erhöhung der AHV-Renten mit Hilfe der Erträge aus der Erbschaftsteuer führt zu mehr Konsum, was die Nachfrage nach Güter und Dienstleistungen erhöht. Somit kann mehr produziert werden, was letztlich Arbeitsplätze sichert und den Wirtschaftsstandort Schweiz stärkt. Das ist die wirkliche positive Wirkung der Erbschaftssteuer, wie in der Initiative vorgeschlagen. Und in der Schweiz, in der der Anteil der Rentner und Rentnerinnen an der Gesamtbevölkerung ständig wächst, könnte die Einkommenssteuer durch die Erbschaftssteuer teilweise ersetzt werden, was die Erwerbstätigen etwas entlasten würde. Deshalb ist die logischen Folge: Ja zur Eidgenössische Volksinitiative ‚Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV’ am 16. Juni 2015.